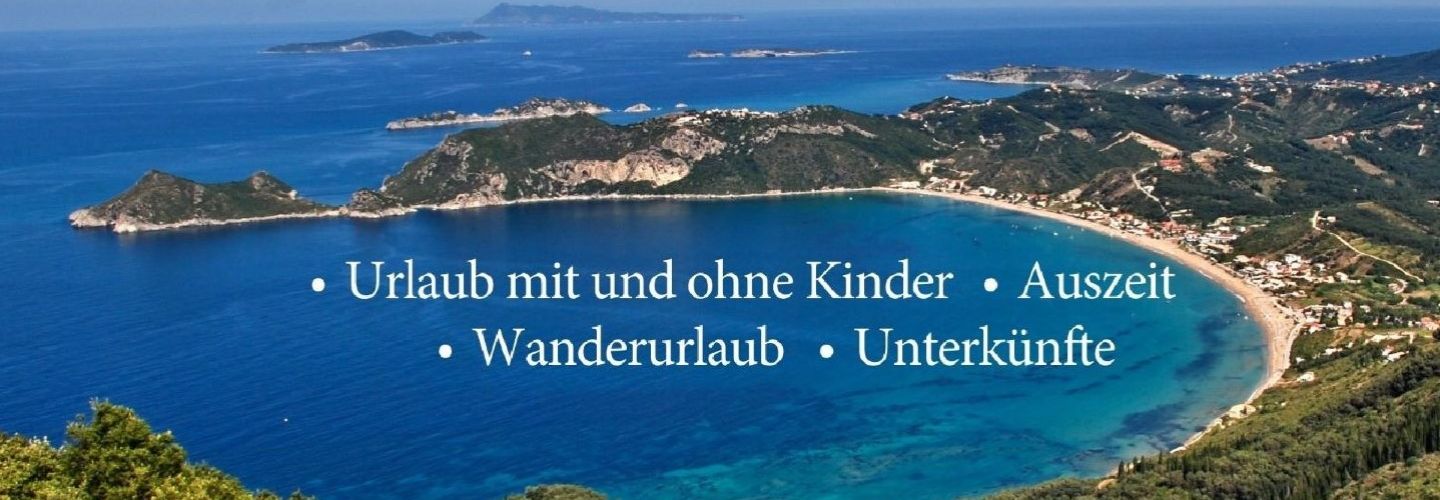Im Land der Esel und der Großmütter
Wandern in den Bergen ist schon an sich anstrengend. Die Esel tragen zwar unser Gepäck und entlasten uns damit. Aber am zweiten Tag bin ich noch nicht so vertraut mit ihnen, ziehe und zerre an Valerio, der immer wieder stehen bleibt, um Gras zu fressen, und weiß trotz der gestrigen Einweisung unserer Eselvermieterin nicht, ob ich ihn richtig behandle. "Nicht nachgeben, genauso stur wie die Esel sein", hatte sie gesagt. Jetzt fürchte ich mich, einfach so. Was, wenn die Esel verweigern? Sie werden uns bestimmt nicht folgen und sind stärker als wir.
Juliane lockt weiter, ich raschle weiter und nach gefühlten Stunden, in denen ich innerlich längst aufgegeben habe und Juliane weiter beruhigend auf Rosina und mich eingeredet hat, geht die verfressene Eselin einen Schritt vorwärts. Pause. Und dann noch einen Schritt, der Bann ist gebrochen. Juliane hat es geschafft und belohnt Rosina am Ende des Engpasses mit Futter und Streicheln. Das lässt Valerio, der Leitesel, nicht einfach mit sich geschehen. Er wendet ruckartig und kommt, das Gepäck an der Geröllwand entlang schurrend, hinter uns her galoppiert.
De Esel waren klüger als wir, wie wir später feststellen mussten. Sie verweigerten zu Recht, denn wir hatten einen falschen Pfad eingeschlagen und mussten zurück. Aber wer kann schon die wenigen schwierigen Situationen in der Erinnerung wichtig nehmen- außer zu Selbsterkenntniszwecken, wenn er das Privileg hat, in einem so ursprünglichen Berggebiet wie dem Nationalpark Sirente-Velino zu wandern. Alles ist in spätsommerlich hellstes Licht getaucht, der Himmel aufgrund der Höhe tiefblau. In den Berghängen röhren schon morgens die Hirsche, es ist Brunftzeit. Die wenigen, trotz Landflucht verbliebenen Landwirte in dieser Gegend leiden unter dem Rot- und Schwarzwild. Es darf nicht geschossen werden, und die auf das Wild angesetzten Wölfe schaffen es nicht, den Bestand zu dezimieren.
Wir sehen aber kaum Wild und noch weniger Menschen auf unserer Wanderung. Die Landschaft ist so unberührt! Überall haben wir Ausblicke auf das Massiv des Gran Sasso, der Majella und andere Gipfel der Abruzzen. Terrassierte Felder mit verfallenen Steinmauern, in denen sich Eidechsen, Insekten und Nattern vor uns verstecken, Steineichen und Buchenwälder, Pappeln an den Flussrändern, Wiesen mit letzten Disteln, Johanniskraut, Skabiosen und blühenden Gräsern, die in Gelb-und Grüntönen zittrig in der Sonne glitzern, begleiten uns. In höheren Lagen graue, trockene Abschnitte mit windzerzausten Wachholderbüschen auf karstigem Untergrund. Und an den Waldwegen finden wir große Horte blühender rosa Alpenveilchen. Alles durchstreifen wir auf oft hellgelben, sandfarbenen Wegen mit weißlichen Steinen; Steinen mit denen auch die mittelalterlichen über und unter uns thronenden Dörfer in der Sonne gleißen.
Am Ufer des Aterno kommen wir über eine römische Brücke und eine Kapelle mit Fresken aus dem 15 Jahrhundert; vor Goriano Valli passieren wir einem römischen Wachturm. Hätten wir mehr Muße, wir würden in Fontecchio Brunnen und Plätze besichtigen, in Bonaco Kirchen und auf dem Weg weitere Befestigungen und Torri.
Die Regierung repariert immer noch die Erdbebenschäden von 2009 und 2016: 80% der Sanierungskosten zahlt der Staat, 20% müssen die Einwohner dazu zahlen, die teilweise schon 10 Jahre in Ersatzwohnungen-und Häuschen leben. Da die Häuser erdbebensicher und liebevoll restauriert werden, dauert es unter Umständen 4 Jahre, bis die z.T. noch aus dem 11. Jahrhundert stammenden verwinkelten 2-3stöckigen Häuser wieder hergerichtet sind. Wahrzeichen der Dörfer sind deshalb z.Zt. nicht nur Türme, sondern auch weit in die Täler hinein sichtbare gelbe Kräne. "Für wen der Aufwand?", haben wir uns öfter gefragt, wenn wir durch die manchmal sehr verlassen wirkenden Dörfer spazieren, an vielen Hauswänden kleben "Vendesi", Schilder "zu verkaufen". Luca, ein junger Barbesitzer und B&B Vermieter, hat darauf gleich eine Antwort: "Die jungen Leute ziehen, wenn sie nicht so vernarrt in die Gegend sind wie ich, weg, weil sie keine Arbeit haben. Aber Sie können doch hier ein Haus kaufen und ihre Freunde auch. Die Deutschen haben doch Initiative und Ideen. Dann hat sich das Restaurieren gelohnt".
In Goriano Valli zu wohnen ist jedoch etwas anderes als Wandern. Wandern heißt: Aufstehen und zum nächsten Ort aufbrechen. Vorher notwendige Arbeiten erledigen: für Essen, Trinken, die Wegbeschreibung sorgen. Dann sind die Esel dran: sie müssen versorgt, geputzt und gesattelt werden. Keine störenden Überlegungen, keine gesellschaftlichen Zwänge, kein sich Zurechtmachen, keine unnötigen Gespräche oder andere überflüssige Schnörkeleien. Wir sind für kurze Zeit, wie die Landwirte in den menschenleeren Gebieten, durch die wir wandern, auf ein geregeltes, von den Jahreszeiten und der Natur bestimmtes Leben festgelegt. Das ist entlastend und beruhigend, so empfinde ich es jedenfalls. Meine Sehnsucht nach diesem Eintauchen in die Natur ist auch nach unserer Wanderung nicht "gestillt". Aber würden wir hier ein Ferienhaus haben, müsste ich wieder Beziehungen eingehen, "nett sein", mich um das Haus kümmern und würde schnell wieder überlegen müssen "was machen wir heute?"
Das Leben in diesen geschlossenen Dorfgemeinschaften ist für diejenigen, die geblieben oder aus den Großstädten zurückgekehrt sind einfacher, weil sie so viele gute Erinnerungen an die langen Sommerferien bei den Großeltern haben, weil sie an die sinnvollen Tätigkeiten dieser Großelterngeneration anschließen wollen (und davon gibt es viele- auch Luca z.B. kocht, wie er stolz betonte, nach den Rezepten seiner Nonna; Saskia, unsere Eselvermieterin arbeitet mit den Nachkommen der Esel, die einst das Getreide in die Mühlen brachten): sie sind per se Teil der Gemeinschaft und sind äußerst bemüht, ihre Heimat neu zu beleben.
Aber es ist auch harte Arbeit und keineswegs immer nur idyllisch. Gabriela, z.B., die über 60jährige Winzerin, die ihr Leben lang in Norditalien in großen Unternehmen gearbeitet hat, kehrte mit 50 zurück in ihr Heimatdorf um Wein anzubauen. Daraufhin enterbte ihre Mutter sie, weil sie sich für die Rückkehr der Tochter in ihr armes Dorf schämte. Ihre Kinder schauen skeptisch auf ihre Aussteigermutter und von der erhofften Solidarität der Dorfgemeinschaft ist sie tief enttäuscht. Sie steht, sagt sie, alleine da. Die Wanderinnen genossen ihren sehr guten Wein, ihre liebevolle Bewirtung, waren beeindruckt von so viel Mut und Energie; aber auch bedrückt von der Aura großer Einsamkeit, die die Winzerin ausstrahlte.
Die Liebe zu ihrem Land ist jedoch auch bei ihr trotzdem groß. Und wenn der Mut sinkt, wenn der Winzerin und den Landwirten die Wein oder Safranernte zu oft von Wildschweinen zerstört wird und sie erwägen aufzugeben, sagt bestimmt ein anderer: "Wir schaffen das. So ein Himmel, so ein Licht, das Meer in einer Stunde erreichbar und unsere Berge ringsherum, das findest du nirgendwo." Was wir nach unserer Wanderung gut verstehen können.